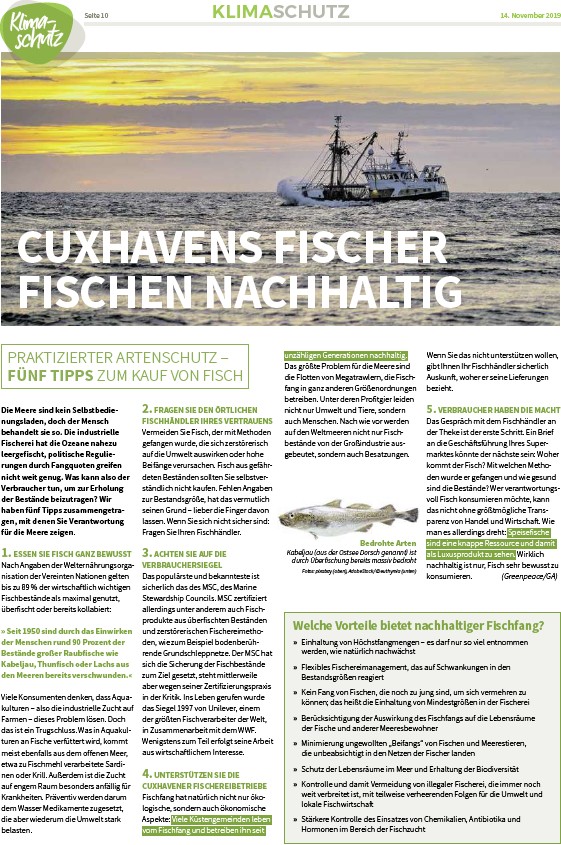
Seite 10 KLIMASCHUTZ 14. November 2019
CUXHAVENS FISCHER
FISCHEN NACHHALTIG
PRAKTIZIERTER ARTENSCHUTZ –
FÜNF TIPPS ZUM KAUF VON FISCH
Bedrohte Arten
Kabeljau (aus der Ostsee Dorsch genannt) ist
durch Überfischung bereits massiv bedroht
Fotos: pixabay (oben), AdobeStock/© euthymia (unten)
Welche Vorteile bietet nachhaltiger Fischfang?
» Einhaltung von Höchstfangmengen – es darf nur so viel entnommen
werden, wie natürlich nachwächst
» Flexibles Fischereimanagement, das auf Schwankungen in den
Bestandsgrößen reagiert
» Kein Fang von Fischen, die noch zu jung sind, um sich vermehren zu
können; das heißt die Einhaltung von Mindestgrößen in der Fischerei
» Berücksichtigung der Auswirkung des Fischfangs auf die Lebensräume
der Fische und anderer Meeresbewohner
» Minimierung ungewollten „Beifangs“ von Fischen und Meerestieren,
die unbeabsichtigt in den Netzen der Fischer landen
» Schutz der Lebensräume im Meer und Erhaltung der Biodiversität
» Kontrolle und damit Vermeidung von illegaler Fischerei, die immer noch
weit verbreitet ist, mit teilweise verheerenden Folgen für die Umwelt und
lokale Fischwirtschaft
» Stärkere Kontrolle des Einsatzes von Chemikalien, Antibiotika und
Hormonen im Bereich der Fischzucht
Die Meere sind kein Selbstbedienungsladen,
doch der Mensch
behandelt sie so. Die industrielle
Fischerei hat die Ozeane nahezu
leergefischt, politische Regulierungen
durch Fangquoten greifen
nicht weit genug. Was kann also der
Verbraucher tun, um zur Erholung
der Bestände beizutragen? Wir
haben fünf Tipps zusammengetragen,
mit denen Sie Verantwortung
für die Meere zeigen.
1. ESSEN SIE FISCH GANZ BEWUSST
Nach Angaben der Welternährungsorganisation
der Vereinten Nationen gelten
bis zu 89 % der wirtschaftlich wichtigen
Fischbestände als maximal genutzt,
überfischt oder bereits kollabiert:
» Seit 1950 sind durch das Einwirken
der Menschen rund 90 Prozent der
Bestände großer Raubfische wie
Kabeljau, Thunfisch oder Lachs aus
den Meeren bereits verschwunden.«
Viele Konsumenten denken, dass Aquakulturen
– also die industrielle Zucht auf
Farmen – dieses Problem lösen. Doch
das ist ein Trugschluss. Was in Aquakulturen
an Fische verfüttert wird, kommt
meist ebenfalls aus dem offenen Meer,
etwa zu Fischmehl verarbeitete Sardinen
oder Krill. Außerdem ist die Zucht
auf engem Raum besonders anfällig für
Krankheiten. Präventiv werden darum
dem Wasser Medikamente zugesetzt,
die aber wiederum die Umwelt stark
belasten.
2. FRAGEN SIE DEN ÖRTLICHEN
FISCHHÄNDLER IHRES VERTRAUENS
Vermeiden Sie Fisch, der mit Methoden
gefangen wurde, die sich zerstörerisch
auf die Umwelt auswirken oder hohe
Beifänge verursachen. Fisch aus gefährdeten
Beständen sollten Sie selbstverständlich
nicht kaufen. Fehlen Angaben
zur Bestandsgröße, hat das vermutlich
seinen Grund – lieber die Finger davon
lassen. Wenn Sie sich nicht sicher sind:
Fragen Sie Ihren Fischhändler.
3. ACHTEN SIE AUF DIE
VERBRAUCHERSIEGEL
Das populärste und bekannteste ist
sicherlich das des MSC, des Marine
Stewardship Councils. MSC zertifiziert
allerdings unter anderem auch Fischprodukte
aus überfischten Beständen
und zerstörerischen Fischereimethoden,
wie zum Beispiel bodenberührende
Grundschleppnetze. Der MSC hat
sich die Sicherung der Fischbestände
zum Ziel gesetzt, steht mittlerweile
aber wegen seiner Zertifizierungspraxis
in der Kritik. Ins Leben gerufen wurde
das Siegel 1997 von Unilever, einem
der größten Fischverarbeiter der Welt,
in Zusammenarbeit mit dem WWF.
Wenigstens zum Teil erfolgt seine Arbeit
aus wirtschaftlichem Interesse.
4. UNTERSTÜTZEN SIE DIE
CUXHAVENER FISCHEREIBETRIEBE
Fischfang hat natürlich nicht nur ökologische,
sondern auch ökonomische
Aspekte: Viele Küstengemeinden leben
vom Fischfang und betreiben ihn seit
unzähligen Generationen nachhaltig.
Das größte Problem für die Meere sind
die Flotten von Megatrawlern, die Fischfang
in ganz anderen Größenordnungen
betreiben. Unter deren Profitgier leiden
nicht nur Umwelt und Tiere, sondern
auch Menschen. Nach wie vor werden
auf den Weltmeeren nicht nur Fischbestände
von der Großindustrie ausgebeutet,
sondern auch Besatzungen.
Wenn Sie das nicht unterstützen wollen,
gibt Ihnen Ihr Fischhändler sicherlich
Auskunft, woher er seine Lieferungen
bezieht.
5. VERBRAUCHER HABEN DIE MACHT
Das Gespräch mit dem Fischhändler an
der Theke ist der erste Schritt. Ein Brief
an die Geschäftsführung Ihres Supermarktes
könnte der nächste sein: Woher
kommt der Fisch? Mit welchen Methoden
wurde er gefangen und wie gesund
sind die Bestände? Wer verantwortungsvoll
Fisch konsumieren möchte, kann
das nicht ohne größtmögliche Transparenz
von Handel und Wirtschaft. Wie
man es allerdings dreht: Speisefische
sind eine knappe Ressource und damit
als Luxusprodukt zu sehen. Wirklich
nachhaltig ist nur, Fisch sehr bewusst zu
konsumieren. (Greenpeace/GA)
Klimaschutz