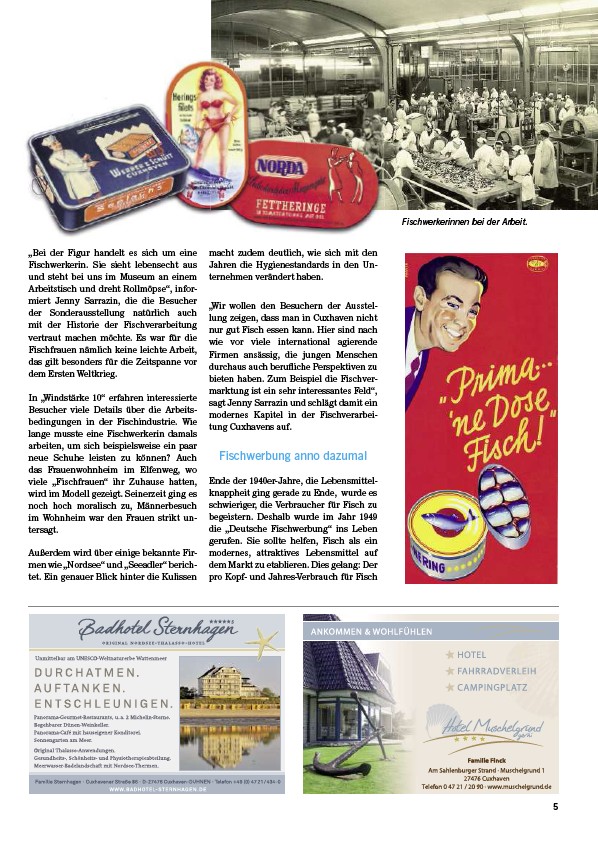
5
„Bei der Figur handelt es sich um eine
Fischwerkerin. Sie sieht lebensecht aus
und steht bei uns im Museum an einem
Arbeitstisch und dreht Rollmöpse“, informiert
Jenny Sarrazin, die die Besucher
der Sonderausstellung natürlich auch
mit der Historie der Fischverarbeitung
vertraut machen möchte. Es war für die
Fischfrauen nämlich keine leichte Arbeit,
das gilt besonders für die Zeitspanne vor
dem Ersten Weltkrieg.
In „Windstärke 10“ erfahren interessierte
Besucher viele Details über die Arbeitsbedingungen
in der Fischindustrie. Wie
lange musste eine Fischwerkerin damals
arbeiten, um sich beispielsweise ein paar
neue Schuhe leisten zu können? Auch
das Frauenwohnheim im Elfenweg, wo
viele „Fischfrauen“ ihr Zuhause hatten,
wird im Modell gezeigt. Seinerzeit ging es
noch hoch moralisch zu, Männerbesuch
im Wohnheim war den Frauen strikt untersagt.
Außerdem wird über einige bekannte Firmen
wie „Nordsee“ und „Seeadler“ berichtet.
Ein genauer Blick hinter die Kulissen
macht zudem deutlich, wie sich mit den
Jahren die Hygienestandards in den Unternehmen
verändert haben.
„Wir wollen den Besuchern der Ausstellung
zeigen, dass man in Cuxhaven nicht
nur gut Fisch essen kann. Hier sind nach
wie vor viele international agierende
Firmen ansässig, die jungen Menschen
durchaus auch berufliche Perspektiven zu
bieten haben. Zum Beispiel die Fischvermarktung
ist ein sehr interessantes Feld“,
sagt Jenny Sarrazin und schlägt damit ein
modernes Kapitel in der Fischverarbeitung
Cuxhavens auf.
Fischwerbung anno dazumal
Ende der 1940er-Jahre, die Lebensmittelknappheit
ging gerade zu Ende, wurde es
schwieriger, die Verbraucher für Fisch zu
begeistern. Deshalb wurde im Jahr 1949
die „Deutsche Fischwerbung“ ins Leben
gerufen. Sie sollte helfen, Fisch als ein
modernes, attraktives Lebensmittel auf
dem Markt zu etablieren. Dies gelang: Der
pro Kopf- und Jahres-Verbrauch für Fisch
Fischwerkerinnen bei der Arbeit.