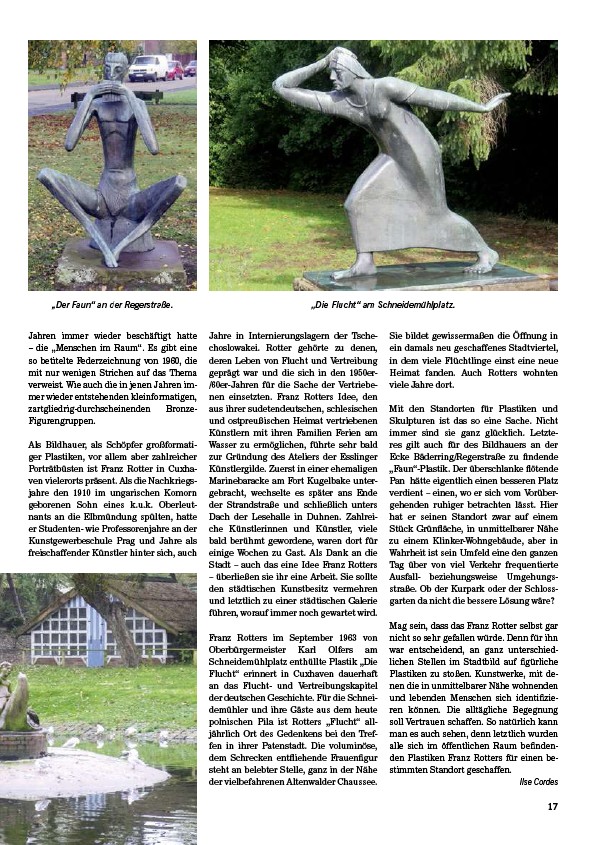
17
Jahren immer wieder beschäftigt hatte
– die „Menschen im Raum“. Es gibt eine
so betitelte Federzeichnung von 1960, die
mit nur wenigen Strichen auf das Thema
verweist. Wie auch die in jenen Jahren immer
wieder entstehenden kleinformatigen,
zartgliedrig-durchscheinenden Bronze-
Figurengruppen.
Als Bildhauer, als Schöpfer großformatiger
Plastiken, vor allem aber zahlreicher
Porträtbüsten ist Franz Rotter in Cuxhaven
vielerorts präsent. Als die Nachkriegsjahre
den 1910 im ungarischen Komorn
geborenen Sohn eines k.u.k. Oberleutnants
an die Elbmündung spülten, hatte
er Studenten- wie Professorenjahre an der
Kunstgewerbeschule Prag und Jahre als
freischaffender Künstler hinter sich, auch
Jahre in Internierungslagern der Tschechoslowakei.
Rotter gehörte zu denen,
deren Leben von Flucht und Vertreibung
geprägt war und die sich in den 1950er-
/60er-Jahren für die Sache der Vertriebenen
einsetzten. Franz Rotters Idee, den
aus ihrer sudetendeutschen, schlesischen
und ostpreußischen Heimat vertriebenen
Künstlern mit ihren Familien Ferien am
Wasser zu ermöglichen, führte sehr bald
zur Gründung des Ateliers der Esslinger
Künstlergilde. Zuerst in einer ehemaligen
Marinebaracke am Fort Kugelbake untergebracht,
wechselte es später ans Ende
der Strandstraße und schließlich unters
Dach der Lesehalle in Duhnen. Zahlreiche
Künstlerinnen und Künstler, viele
bald berühmt gewordene, waren dort für
einige Wochen zu Gast. Als Dank an die
Stadt – auch das eine Idee Franz Rotters
– überließen sie ihr eine Arbeit. Sie sollte
den städtischen Kunstbesitz vermehren
und letztlich zu einer städtischen Galerie
führen, worauf immer noch gewartet wird.
Franz Rotters im September 1963 von
Oberbürgermeister Karl Olfers am
Schneidemühlplatz enthüllte Plastik „Die
Flucht“ erinnert in Cuxhaven dauerhaft
an das Flucht- und Vertreibungskapitel
der deutschen Geschichte. Für die Schneidemühler
und ihre Gäste aus dem heute
polnischen Pila ist Rotters „Flucht“ alljährlich
Ort des Gedenkens bei den Treffen
in ihrer Patenstadt. Die voluminöse,
dem Schrecken entfliehende Frauenfigur
steht an belebter Stelle, ganz in der Nähe
der vielbefahrenen Altenwalder Chaussee.
Sie bildet gewissermaßen die Öffnung in
ein damals neu geschaffenes Stadtviertel,
in dem viele Flüchtlinge einst eine neue
Heimat fanden. Auch Rotters wohnten
viele Jahre dort.
Mit den Standorten für Plastiken und
Skulpturen ist das so eine Sache. Nicht
immer sind sie ganz glücklich. Letzteres
gilt auch für des Bildhauers an der
Ecke Bäderring/Regerstraße zu findende
„Faun“-Plastik. Der überschlanke flötende
Pan hätte eigentlich einen besseren Platz
verdient – einen, wo er sich vom Vorübergehenden
ruhiger betrachten lässt. Hier
hat er seinen Standort zwar auf einem
Stück Grünfläche, in unmittelbarer Nähe
zu einem Klinker-Wohngebäude, aber in
Wahrheit ist sein Umfeld eine den ganzen
Tag über von viel Verkehr frequentierte
Ausfall- beziehungsweise Umgehungsstraße.
Ob der Kurpark oder der Schlossgarten
da nicht die bessere Lösung wäre?
Mag sein, dass das Franz Rotter selbst gar
nicht so sehr gefallen würde. Denn für ihn
war entscheidend, an ganz unterschiedlichen
Stellen im Stadtbild auf figürliche
Plastiken zu stoßen. Kunstwerke, mit denen
die in unmittelbarer Nähe wohnenden
und lebenden Menschen sich identifizieren
können. Die alltägliche Begegnung
soll Vertrauen schaffen. So natürlich kann
man es auch sehen, denn letztlich wurden
alle sich im öffentlichen Raum befindenden
Plastiken Franz Rotters für einen bestimmten
Standort geschaffen.
Ilse Cordes
„Der Faun“ an der Regerstraße. „Die Flucht“ am Schneidemühlplatz.