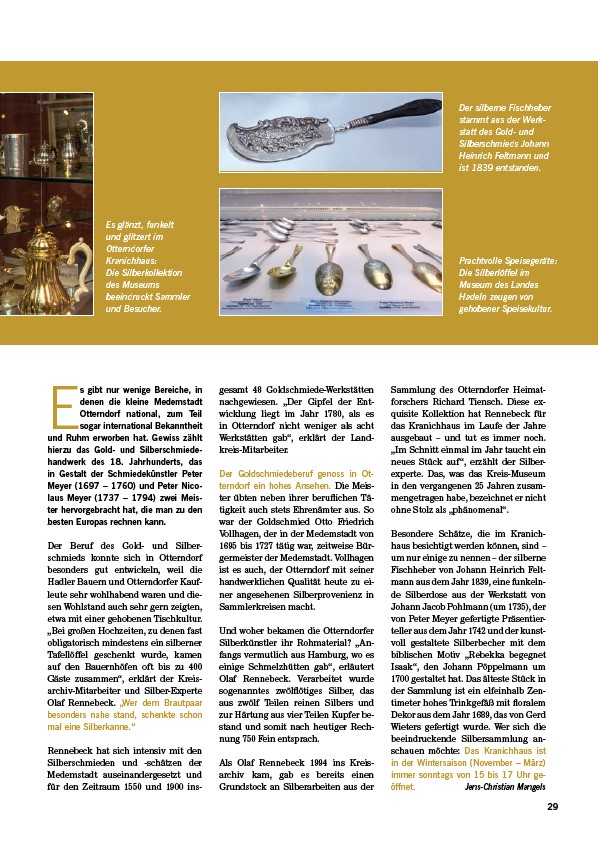
Prachtvolle Speisegeräte:
Die Silberlöffel im
Museum des Landes
Hadeln zeugen von
gehobener Speisekultur.
29
Es glänzt, funkelt
und glitzert im
Otterndorfer
Kranichhaus:
Die Silberkollektion
des Museums
beeindruckt Sammler
und Besucher.
Der silberne Fischheber
stammt aus der Werkstatt
des Gold- und
Silberschmieds Johann
Heinrich Feltmann und
ist 1839 entstanden.
Es gibt nur wenige Bereiche, in
denen die kleine Medemstadt
Otterndorf national, zum Teil
sogar international Bekanntheit
und Ruhm erworben hat. Gewiss zählt
hierzu das Gold- und Silberschmiedehandwerk
des 18. Jahrhunderts, das
in Gestalt der Schmiedekünstler Peter
Meyer (1697 – 1760) und Peter Nicolaus
Meyer (1737 – 1794) zwei Meister
hervorgebracht hat, die man zu den
besten Europas rechnen kann.
Der Beruf des Gold- und Silberschmieds
konnte sich in Otterndorf
besonders gut entwickeln, weil die
Hadler Bauern und Otterndorfer Kaufleute
sehr wohlhabend waren und diesen
Wohlstand auch sehr gern zeigten,
etwa mit einer gehobenen Tischkultur.
„Bei großen Hochzeiten, zu denen fast
obligatorisch mindestens ein silberner
Tafellöffel geschenkt wurde, kamen
auf den Bauernhöfen oft bis zu 400
Gäste zusammen“, erklärt der Kreisarchiv
Mitarbeiter und Silber-Experte
Olaf Rennebeck. „Wer dem Brautpaar
besonders nahe stand, schenkte schon
mal eine Silberkanne.“
Rennebeck hat sich intensiv mit den
Silberschmieden und -schätzen der
Medemstadt auseinandergesetzt und
für den Zeitraum 1550 und 1900 insgesamt
48 Goldschmiede-Werkstätten
nachgewiesen. „Der Gipfel der Entwicklung
liegt im Jahr 1780, als es
in Otterndorf nicht weniger als acht
Werkstätten gab“, erklärt der Landkreis
Mitarbeiter.
Der Goldschmiedeberuf genoss in Otterndorf
ein hohes Ansehen. Die Meister
übten neben ihrer beruflichen Tätigkeit
auch stets Ehrenämter aus. So
war der Goldschmied Otto Friedrich
Vollhagen, der in der Medemstadt von
1695 bis 1727 tätig war, zeitweise Bürgermeister
der Medemstadt. Vollhagen
ist es auch, der Otterndorf mit seiner
handwerklichen Qualität heute zu einer
angesehenen Silberprovenienz in
Sammlerkreisen macht.
Und woher bekamen die Otterndorfer
Silberkünstler ihr Rohmaterial? „Anfangs
vermutlich aus Hamburg, wo es
einige Schmelzhütten gab“, erläutert
Olaf Rennebeck. Verarbeitet wurde
sogenanntes zwölflötiges Silber, das
aus zwölf Teilen reinen Silbers und
zur Härtung aus vier Teilen Kupfer bestand
und somit nach heutiger Rechnung
750 Fein entsprach.
Als Olaf Rennebeck 1994 ins Kreisarchiv
kam, gab es bereits einen
Grundstock an Silberarbeiten aus der
Sammlung des Otterndorfer Heimatforschers
Richard Tiensch. Diese exquisite
Kollektion hat Rennebeck für
das Kranichhaus im Laufe der Jahre
ausgebaut – und tut es immer noch.
„Im Schnitt einmal im Jahr taucht ein
neues Stück auf“, erzählt der Silberexperte.
Das, was das Kreis-Museum
in den vergangenen 25 Jahren zusammengetragen
habe, bezeichnet er nicht
ohne Stolz als „phänomenal“.
Besondere Schätze, die im Kranichhaus
besichtigt werden können, sind –
um nur einige zu nennen – der silberne
Fischheber von Johann Heinrich Feltmann
aus dem Jahr 1839, eine funkelnde
Silberdose aus der Werkstatt von
Johann Jacob Pohlmann (um 1735), der
von Peter Meyer gefertigte Präsentierteller
aus dem Jahr 1742 und der kunstvoll
gestaltete Silberbecher mit dem
biblischen Motiv „Rebekka begegnet
Isaak“, den Johann Pöppelmann um
1700 gestaltet hat. Das älteste Stück in
der Sammlung ist ein elfeinhalb Zentimeter
hohes Trinkgefäß mit floralem
Dekor aus dem Jahr 1689, das von Gerd
Wieters gefertigt wurde. Wer sich die
beeindruckende Silbersammlung anschauen
möchte: Das Kranichhaus ist
in der Wintersaison (November – März)
immer sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Jens-Christian Mangels