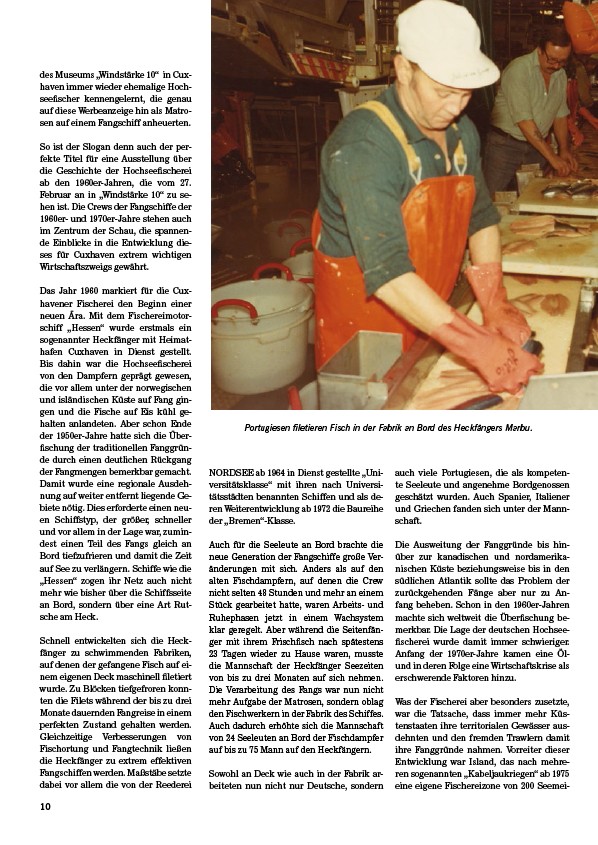
des Museums „Windstärke 10“ in Cuxhaven
10
immer wieder ehemalige Hochseefischer
kennengelernt, die genau
auf diese Werbeanzeige hin als Matrosen
auf einem Fangschiff anheuerten.
So ist der Slogan denn auch der perfekte
Titel für eine Ausstellung über
die Geschichte der Hochseefischerei
ab den 1960er-Jahren, die vom 27.
Februar an in „Windstärke 10“ zu sehen
ist. Die Crews der Fangschiffe der
1960er- und 1970er-Jahre stehen auch
im Zentrum der Schau, die spannende
Einblicke in die Entwicklung dieses
für Cuxhaven extrem wichtigen
Wirtschaftszweigs gewährt.
Das Jahr 1960 markiert für die Cuxhavener
Fischerei den Beginn einer
neuen Ära. Mit dem Fischereimotorschiff
„Hessen“ wurde erstmals ein
sogenannter Heckfänger mit Heimathafen
Cuxhaven in Dienst gestellt.
Bis dahin war die Hochseefischerei
von den Dampfern geprägt gewesen,
die vor allem unter der norwegischen
und isländischen Küste auf Fang gingen
und die Fische auf Eis kühl gehalten
anlandeten. Aber schon Ende
der 1950er-Jahre hatte sich die Überfischung
der traditionellen Fanggründe
durch einen deutlichen Rückgang
der Fangmengen bemerkbar gemacht.
Damit wurde eine regionale Ausdehnung
auf weiter entfernt liegende Gebiete
nötig. Dies erforderte einen neuen
Schiffstyp, der größer, schneller
und vor allem in der Lage war, zumindest
einen Teil des Fangs gleich an
Bord tiefzufrieren und damit die Zeit
auf See zu verlängern. Schiffe wie die
„Hessen“ zogen ihr Netz auch nicht
mehr wie bisher über die Schiffsseite
an Bord, sondern über eine Art Rutsche
am Heck.
Schnell entwickelten sich die Heckfänger
zu schwimmenden Fabriken,
auf denen der gefangene Fisch auf einem
eigenen Deck maschinell filetiert
wurde. Zu Blöcken tiefgefroren konnten
die Filets während der bis zu drei
Monate dauernden Fangreise in einem
perfekten Zustand gehalten werden.
Gleichzeitige Verbesserungen von
Fischortung und Fangtechnik ließen
die Heckfänger zu extrem effektiven
Fangschiffen werden. Maßstäbe setzte
dabei vor allem die von der Reederei
Portugiesen filetieren Fisch in der Fabrik an Bord des Heckfängers Marbu.
NORDSEE ab 1964 in Dienst gestellte „Universitätsklasse“
mit ihren nach Universitätsstädten
benannten Schiffen und als deren
Weiterentwicklung ab 1972 die Baureihe
der „Bremen“-Klasse.
Auch für die Seeleute an Bord brachte die
neue Generation der Fangschiffe große Veränderungen
mit sich. Anders als auf den
alten Fischdampfern, auf denen die Crew
nicht selten 48 Stunden und mehr an einem
Stück gearbeitet hatte, waren Arbeits- und
Ruhephasen jetzt in einem Wachsystem
klar geregelt. Aber während die Seitenfänger
mit ihrem Frischfisch nach spätestens
23 Tagen wieder zu Hause waren, musste
die Mannschaft der Heckfänger Seezeiten
von bis zu drei Monaten auf sich nehmen.
Die Verarbeitung des Fangs war nun nicht
mehr Aufgabe der Matrosen, sondern oblag
den Fischwerkern in der Fabrik des Schiffes.
Auch dadurch erhöhte sich die Mannschaft
von 24 Seeleuten an Bord der Fischdampfer
auf bis zu 75 Mann auf den Heckfängern.
Sowohl an Deck wie auch in der Fabrik arbeiteten
nun nicht nur Deutsche, sondern
auch viele Portugiesen, die als kompetente
Seeleute und angenehme Bordgenossen
geschätzt wurden. Auch Spanier, Italiener
und Griechen fanden sich unter der Mannschaft.
Die Ausweitung der Fanggründe bis hinüber
zur kanadischen und nordamerikanischen
Küste beziehungsweise bis in den
südlichen Atlantik sollte das Problem der
zurückgehenden Fänge aber nur zu Anfang
beheben. Schon in den 1960er-Jahren
machte sich weltweit die Überfischung bemerkbar.
Die Lage der deutschen Hochseefischerei
wurde damit immer schwieriger.
Anfang der 1970er-Jahre kamen eine Öl-
und in deren Folge eine Wirtschaftskrise als
erschwerende Faktoren hinzu.
Was der Fischerei aber besonders zusetzte,
war die Tatsache, dass immer mehr Küstenstaaten
ihre territorialen Gewässer ausdehnten
und den fremden Trawlern damit
ihre Fanggründe nahmen. Vorreiter dieser
Entwicklung war Island, das nach mehreren
sogenannten „Kabeljaukriegen“ ab 1975
eine eigene Fischereizone von 200 Seemei-