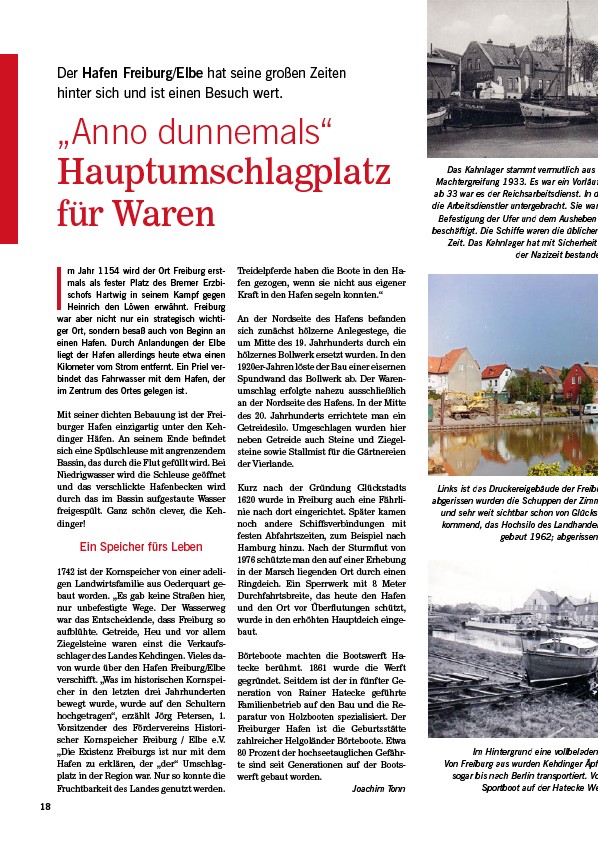
Der Hafen Freiburg/Elbe hat seine großen Zeiten
hinter sich und ist einen Besuch wert.
„Anno dunnemals“
Hauptumschlagplatz
für Waren
Das Kahnlager stammt vermutlich aus Machtergreifung 1933. Es war ein Vorläufer ab 33 war es der Reichsarbeitsdienst. In diesem die Arbeitsdienstler untergebracht. Sie waren Befestigung der Ufer und dem Ausheben beschäftigt. Die Schiffe waren die üblichen Zeit. Das Kahnlager hat mit Sicherheit der Nazizeit bestanden.
Im Jahr 1154 wird der Ort Freiburg erstmals
18
als fester Platz des Bremer Erzbischofs
Hartwig in seinem Kampf gegen
Heinrich den Löwen erwähnt. Freiburg
war aber nicht nur ein strategisch wichtiger
Ort, sondern besaß auch von Beginn an
einen Hafen. Durch Anlandungen der Elbe
liegt der Hafen allerdings heute etwa einen
Kilometer vom Strom entfernt. Ein Priel verbindet
das Fahrwasser mit dem Hafen, der
im Zentrum des Ortes gelegen ist.
Mit seiner dichten Bebauung ist der Freiburger
Hafen einzigartig unter den Kehdinger
Häfen. An seinem Ende befindet
sich eine Spülschleuse mit angrenzendem
Bassin, das durch die Flut gefüllt wird. Bei
Niedrigwasser wird die Schleuse geöffnet
und das verschlickte Hafenbecken wird
durch das im Bassin aufgestaute Wasser
freigespült. Ganz schön clever, die Kehdinger!
Ein Speicher fürs Leben
1742 ist der Kornspeicher von einer adeligen
Landwirtsfamilie aus Oederquart gebaut
worden. „Es gab keine Straßen hier,
nur unbefestigte Wege. Der Wasserweg
war das Entscheidende, dass Freiburg so
aufblühte. Getreide, Heu und vor allem
Ziegelsteine waren einst die Verkaufsschlager
des Landes Kehdingen. Vieles davon
wurde über den Hafen Freiburg/Elbe
verschifft. „Was im historischen Kornspeicher
in den letzten drei Jahrhunderten
bewegt wurde, wurde auf den Schultern
hochgetragen“, erzählt Jörg Petersen, 1.
Vorsitzender des Fördervereins Historischer
Kornspeicher Freiburg / Elbe e.V.
„Die Existenz Freiburgs ist nur mit dem
Hafen zu erklären, der „der“ Umschlagplatz
in der Region war. Nur so konnte die
Fruchtbarkeit des Landes genutzt werden.
Treidelpferde haben die Boote in den Hafen
gezogen, wenn sie nicht aus eigener
Kraft in den Hafen segeln konnten.“
An der Nordseite des Hafens befanden
sich zunächst hölzerne Anlegestege, die
um Mitte des 19. Jahrhunderts durch ein
hölzernes Bollwerk ersetzt wurden. In den
1920er-Jahren löste der Bau einer eisernen
Spundwand das Bollwerk ab. Der Warenumschlag
erfolgte nahezu ausschließlich
an der Nordseite des Hafens. In der Mitte
des 20. Jahrhunderts errichtete man ein
Getreidesilo. Umgeschlagen wurden hier
neben Getreide auch Steine und Ziegelsteine
sowie Stallmist für die Gärtnereien
der Vierlande.
Kurz nach der Gründung Glückstadts
1620 wurde in Freiburg auch eine Fährlinie
nach dort eingerichtet. Später kamen
noch andere Schiffsverbindungen mit
festen Abfahrtszeiten, zum Beispiel nach
Hamburg hinzu. Nach der Sturmflut von
1976 schützte man den auf einer Erhebung
in der Marsch liegenden Ort durch einen
Ringdeich. Ein Sperrwerk mit 8 Meter
Durchfahrtsbreite, das heute den Hafen
und den Ort vor Überflutungen schützt,
wurde in den erhöhten Hauptdeich eingebaut.
Börteboote machten die Bootswerft Hatecke
berühmt. 1861 wurde die Werft
gegründet. Seitdem ist der in fünfter Generation
von Rainer Hatecke geführte
Familienbetrieb auf den Bau und die Reparatur
von Holzbooten spezialisiert. Der
Freiburger Hafen ist die Geburtsstätte
zahlreicher Helgoländer Börteboote. Etwa
80 Prozent der hochseetauglichen Gefährte
sind seit Generationen auf der Bootswerft
gebaut worden.
Joachim Tonn
ist das Druckereigebäude der Freiburger abgerissen wurden die Schuppen der Zimmerei und sehr weit sichtbar schon von Glückstadt kommend, das Hochsilo des Landhandels gebaut 1962; abgerissen Im Hintergrund eine vollbeladene Von Freiburg aus wurden Kehdinger Äpfel sogar bis nach Berlin transportiert. Vorne Sportboot auf der Hatecke Werft Links